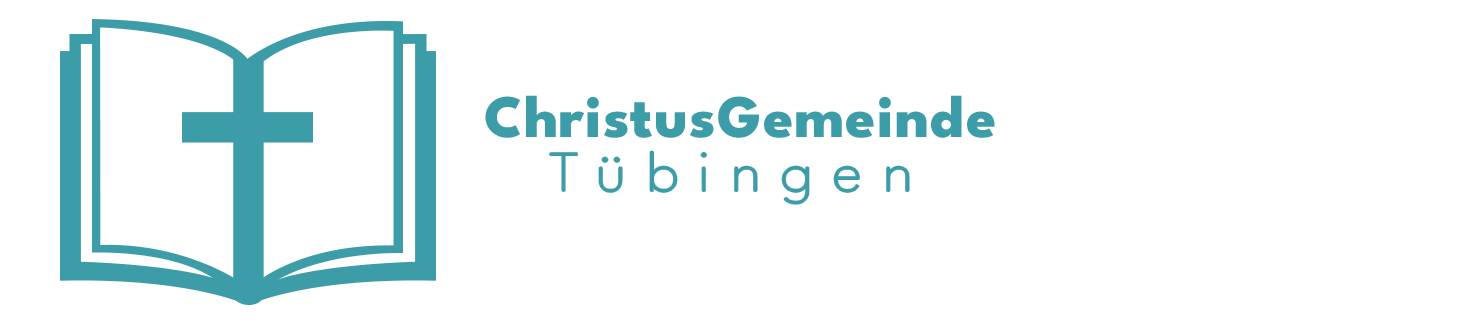Unser gemeindeeigenes Glaubensbekenntnis fußt auf vielen historischen Bekenntnissen und fühlt sich mit allen Christen weltweit verbunden, die mit uns bekennen können: Erlösung ist aus Gnade allein, durch Glauben allein, in Christus allein, nach der Schrift allein, zur Ehre Gottes allein.
Das Tübinger Glaubensbekenntnis
Dies ist eine Zusammenfassung unseres Bekenntnisses für den schnellen Überblick – um den ganzen Text zu sehen, bitte auf den einzelnen Abschnitt klicken.
Präambel
Wir erkennen an, dass jedes Glaubensbekenntnis lediglich ein Versuch von Menschen ist, die Reichtümer der unfehlbaren göttlichen Offenbarung zusammenzufassen und niederzuschreiben. Wir unternehmen diesen Versuch in dem Bewusstsein, dass wir fehlbar sind und unsere Erkenntnis „Stückwerk“ (1Kor 13,9.12) ist. Allein das Wort Gottes ist die unfehlbare Norm und Grundlage für Glauben und Leben. Die exemplarisch angeführten Bibelstellen bilden die Grundlage für die jeweiligen Lehraussagen.
1. Lehrverständnis zur Heiligen Schrift
Wir bekennen und lehren, dass alle 66 Bücher der Heiligen Schrift, das von Gottes Geist inspirierte, unfehlbare und einzig autoritative Wort für Lehre und Leben ist, und sie von Christus her gelesen und verkündigt werden muss.
Wir bekennen und lehren, dass die Bibel Gottes geschriebene Offenbarung an den Menschen ist. Alle 66 Bücher sind gleichermaßen in allen Teilen durch den Heiligen Geist eingegeben und stellen das vollständige Wort Gottes dar (2Tim 3,14-17; 2Petr 1,20.21). Darum ist die Bibel die objektive Offenbarung der Lehre Gottes (1Kor 2,13; 1Thess 2,13), bis zu den Worten der Originalschriften völlig inspiriert, absolut irrtumslos, unfehlbar und von Gott eingehaucht (2Tim 3,16).
Wir bekennen und lehren, dass Gott in seinem Wort durch den Prozess einer zweifachen Autorenschaft spricht (Verbalinspiration bzw. Ganzinspiration). Der Heilige Geist hat die menschlichen Autoren derart überwacht, dass sie durch ihre individuellen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Schreibstile Gottes Wort an die Menschen ohne Fehler in Teilen oder seiner Gesamtheit zusammengestellt (Kanon) und niedergeschrieben haben (Mt 5,18; Joh 14,26; 16,13; 2Tim 3,16; 2Petr 1,20-21).
Wir bekennen und lehren, dass sowohl das Alte, wie auch das Neue Testament christologisch ausgelegt werden muss, da die ganze Schrift auf Jesus Christus hin geschrieben wurde und somit von Ihm redet (Lk 24,44; Joh 5,39.46; Kol 2,17). Wir bekennen uns dabei zur Verwendung der wörtlichen, kanonischen, biblisch-theologischen und grammatisch-historischen Auslegung. Da die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, muss sie dabei jedoch geistlich gedeutet werden (Joh 6,63; Röm 7,14; 1Kor 2,13.14).
Wir bekennen und lehren, dass es in der Verantwortung des Gläubigen (keiner kirchlichen Institution) liegt, die tatsächliche von Gott vorgegebene Absicht und Bedeutung der Schrift sorgfältig durch den Geist zu erarbeiten (Apg 17,11; Kol 1,9.10), wobei zu beachten ist, dass eine angemessene Anwendung für alle Generationen bindend ist. Gottes Wort hat dabei in den allermeisten Fragen die nötige Klarheit, um zu eindeutigen Aussagen zu kommen (1Tim 6,3.4; 2Tim 4,1-5; 2Petr 3,15.16). Es stellt dabei allemal den Menschen in Frage (Röm 3,19; Hebr 4,12); dem Menschen steht es jedoch niemals zu, Gottes Wort in Frage zu stellen (Hi 42,5.6; Röm 9,19.20)!
Wir bekennen und lehren, dass die Bibel die einzige unfehlbare und autoritative Richtschnur (Mt 5,18; 24,35) für den christlichen Glauben und seine praktische Umsetzung (Hebr 4,12; 2Petr 1,20.21) für alle Völker, Zeiten, Kulturen und Generationen ist (Apg 17,30; Röm 4,23; 15,4; Hebr 4,2).
2. Gott (Eigentliche Theologie)
Die Schrift lehrt, dass es nur einen ewigen dreieinigen Gott gibt, der als souveräner Schöpfer und Erhalter alle Dinge zu Seiner Ehre nach Seinem Ratschluss regiert. Dieser Gott hat sich als heiliger, gnädiger und gerechter Vater offenbart. In Seinem Sohn Jesus Christus wurde Gott Mensch, lebte vollkommen gerecht, starb stellvertretend am Kreuz für Sein Volk und stand siegreich vom Tod auf, um wieder vom himmlischen Thron her zu regieren. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott in jedem Gläubigen zur Rettung und Heiligung.
Die Schrift lehrt, dass es nur einen lebendigen und wahren Gott gibt (5Mose 6,4; Jes 45,5-7; 1Kor 8,4), der ewiger und allwissender Geist ist (Joh 4,24), der in allen seinen Eigenschaften vollkommen ist, im Wesen eins und ewiglich in drei Personen existiert – Vater, Sohn und Heiliger Geist (Mt 28,19; Mk 1,10.11; 1Kor 12,4-6; 2Kor 13,14). Der Vater wird durch den Sohn im Heiligen Geist angebetet (Joh 4,23).
2.1. Gott, der Vater
Die Schrift lehrt, dass Gott der Vater als erste Person der Dreieinigkeit, alle Dinge Seinen Absichten und Seiner Gnade entsprechend lenkt und vollbringt (Ps 145,9.10; 1Kor 8,6). Er ist der Schöpfer aller Dinge (1Mose 1,1-31; Eph 3,9). Als der einzige absolute und allmächtige Herrscher im Universum ist Er in der Schöpfung, der Vorsehung und der Erlösung souverän (Hi 38,12-15.31-35; Ps 103,19; Jes 40,12ff; Jer 32,17-20; Röm 11,36).
Seine Vaterschaft beinhaltet sowohl Seine Stellung in der Dreieinigkeit als auch Seine Beziehung zur Menschheit. Als Schöpfer ist Er der Vater aller Menschen (Apg 17,28; Eph 3,15), ein geistlicher Vater ist Er aber nur für die Gläubigen (Röm 8,14; 2Kor 6,18; 1Tim 4,10). Alles was geschieht hat Er vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, dass es Seiner Verherrlichung dient (Röm 9,22; Eph 1,11.12). Fortwährend erhält, lenkt und regiert Er alle Geschöpfe und Ereignisse (1Chr 29,11; Jes 14,24.27).
In Seiner Souveränität ist Er weder Urheber noch Befürworter der Sünde (Hab 1,13; Joh 8,38-47, Jak 1,13-15), noch schränkt Er die Verantwortlichkeit moralischer und intelligenter Geschöpfe ein (Röm 1,18-20; 1Petr 1,17). In Seiner Gnade hat Er von Ewigkeit her die erwählt, die Sein Eigen sein sollen (Eph 1,4-6). Er errettet alle von der Sünde, die ihn anrufen und ist durch Wiedergeburt ihr Vater (Joh 1,12.13; Röm 8,15; Gal 4,5; Hebr 12,5-9).
2.2. Gott, der Sohn (Christologie)
Die Schrift lehrt, dass Jesus Christus als zweite Person der Dreieinigkeit (Ps 45,7.8 vgl. Hebr 1,8.9; Joh 20,28; Röm 9,5; 1Joh 5,20), alle göttlichen Eigenschaften besitzt und folglich ewiglich wesensgleich mit dem Vater ist (Joh 10,30; 14,9; 17,11). Gott, der Vater, hat Seinem eigenen Willen entsprechend „die Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist“ durch, zu und für Seinen Sohn Jesus Christus geschaffen (Joh 1,3; Hebr 1,2), der alle Dinge trägt und erhält, sodass sie überhaupt Existenz und Leben haben (Röm 11,36; Kol 1,15-17).
Unser Herr Jesus Christus wurde nach Verheißung durch den Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau Maria geboren (Jes 7,14; Mt 1,23.25; Lk 1,26-35), und war somit der fleischgewordene Gott (Joh 1,1.14). Er nahm alle menschlichen Eigenschaften an, stand durch die Geistzeugung und Jungfrauengeburt jedoch nicht in der verdorbenen Erbsündenlinie Adams (vgl. Lk 1,35). Die Absicht Seiner Inkarnation (Menschwerdung) bestand v.a. darin, Gottes Wesen (Joh 1,18; 14,9), die Erlösung der Menschheit (Joh 3,17; 2Tim 1,9.10), und Seine Herrschaft sichtbar zu machen (Ps 2,7-9; Jes 9,5.6; Mt 12,28; 28,18), sodass Gott durch die Ausführung Seines Ratschlusses alle Ehre erhält (Phil 2,7.11; Hebr 1,2.3).
Christus gab bei der Inkarnation nur die Vorrechte seiner Gottheit auf, aber nichts von Seinem göttlichen Wesen, weder in Ausmaß noch Art. In der Menschwerdung hat diese ewig bestehende Person der Dreieinigkeit alle wichtigen Eigenschaften des Menschseins angenommen und wurde somit der „Gott-Mensch“ (Phil 2,5-8; Kol 2,9; Hebr 4,15). Jesus Christus ist seitdem Mensch und Gott in untrennbarer Einheit, und besitzt diese zwei Naturen in unvermischter Form (Dan 7,13; Mi 5,1; Joh 10,30; 14,9; Offb 1,13).
Jesus Christus wurde unter das Gesetz geboren (Gal 4,4) und erfüllte es vollkommen (Mt 5,17), indem Er trotz Versuchungen in allem gehorsam war, und somit als Einziger sündlos und Gott wohlgefällig lebte (Hebr 2,17.18; 4,15; 1Petr 2,22; 1Joh 3,5). Seine Göttlichkeit, sowie Seine Sendung zur Verkündigung des Evangeliums und zur stellvertretenden Sühne, wurden durch buchstäbliche Zeichen und Wunder bestätigt (Mk 1,38; Joh 3,2; Apg 2,22).
Unser Herr Jesus Christus erwirkte den einzigmöglichen Weg der Erlösung durch das Vergießen Seines Blutes im Opfertod am Kreuz (Sühnung). Sein Tod war freiwillig, ersetzend, stellvertretend, versöhnend und erlösend (Joh 10,15-18; Apg 4,12; Röm 3,24.25; 5,8; Hebr 9,10; 10,9; 1Petr 2,24).
Gott bestätigte durch die buchstäbliche, leibliche Auferstehung Jesu von den Toten die Gottheit Seines Sohnes und bewies außerdem, dass er das Versöhnungswerk Christi am Kreuz angenommen hat (Lk 24,38.39; Apg 2,30.31; Röm 1,4; 4,25). An Himmelfahrt setzte Christus sich zur Rechten des Vaters, wo Er nun als Hohepriester für die Gläubigen eintritt (Röm 8,34; Hebr 7,25-27; 9,24; 1Joh 2,1). Dies ist auch die Gewähr für ein zukünftiges Auferstehungsleben aller Gläubigen (Joh 5,26-29; 14,1-6; 1Kor 15,20-23).
Gegenwärtig herrscht Christus auf dem Thron Davids als König über Himmel und Erde, um den ganzen Ratschluss Gottes auszuführen, indem Er alle Herrschaft unter Seine Füße bringt (Ps 2,6.7; 8,7; Jes 9,6; Mt 28,18; Apg 2,30.34; 15,14-17; 1Kor 15,25; Eph 1,20-22; Offb 1,5). Jesus Christus wird für alle sichtbar auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit zurückkehren (Mt 24,30; Apg 1,11; Offb 1,7), zur Rettung der Seinen und zum Gericht über die Ungläubigen (Joh 5,22.23.28.29).
2.3. Gott, der Heilige Geist (Pneumatologie)
Die Schrift lehrt, dass der Heilige Geist die dritte göttliche Person der Dreieinigkeit ist. Er ist ewig, ursprungslos und hat alle Eigenschaften einer Person der Gottheit, einschließlich Intellekt (1Kor 2,10-13), Gefühl (Eph 4,30), Wille (1Kor 12,11), Ewigkeit (Hebr 9,14), Allgegenwart (Ps 139,7-10), Allwissenheit (Jes 40,13.14), Allmacht (Hi 33,4), Wahrheit (Joh 16,13) und das Leben in sich selbst (Offb 11,11). In allen Seinen göttlichen Eigenschaften ist Er mit dem Vater und dem Sohn gleich und in Substanz eins (Jes 48,12-16; 63,7-10; Mt 28,19; Apg 5,3.4.9; 1Kor 12,4-6; 2Kor 13,13; vgl. auch Jes 6,8-10 mit Apg 28,25.26; und Jer 31,31-34 mit Hebr 8,8; 10,15-17).
Es ist das Werk des Heiligen Geistes, Gottes ganzen Ratschluss im Auftrag Jesu auszuführen (Sach 4,6; Joh 16,7-15; Apg 2,33; Offb 5,6). Wir erkennen Sein souveränes Wirken in der Schöpfung (1Mose 1,2.26), der geschriebenen Offenbarung (2Petr 1,20.21), der Menschwerdung Jesu (Mt 1,18), dem Werk der Erlösung (Joh 3,5.6) und der Vollendung des ganzen Ratschlusses (Röm 8,11.20-23; Eph 1,14).
Der Heilige Geist ist der göttliche Lehrer, der die Propheten und Apostel beim Deuten und Niederschreiben von Gottes Offenbarung geleitet hat (Inspiration – 2Petr 1,19-21). Er war es, der den Propheten des Alten Testaments die Person und das Werk Jesu Christi voraussehend offenbarte und die Apostel des Neuen Testaments zum Zeugnis der Erfüllung dieser Verheißung befähigte (Joh 15,26.27; 1Petr 1,10-12). Zudem besteht Sein Werk heute darin, beim Lesen, Verstehen und Auslegen des geoffenbarten Wortes zu leiten (Illumination – Joh 14,26; 1Kor 2,12-16).
Das Werk des Heiligen Geistes war zu jeder Zeit präsent (1Petr 1,11.12) und wird seit Pfingsten in umfassender Weise sichtbar. Wie Jesus Christus versprochen hatte, kam der Heilige Geist durch Ihn vom Vater (Joh 14,16.17; 15,26; Apg 2,33), um den Bau der schon zu alttestamentlicher Zeit bestehenden wahren Gemeinde zu vollenden (Sach 4,6; Joh 10,16; Röm 11,17; 1Kor 12,13; Eph 2,14-22; Hebr 11,39.40). Sein Werk beinhaltet u.a. das Überführen der Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht (Joh 16,8-11), die Verherrlichung des Herrn Jesus (Joh 16,14) und die Wiedergeburt und Umgestaltung der Gläubigen in das Bild Christi (Röm 8,29.30; 2Kor 3,18; Eph 2,22).
Der Heilige Geist wirkt die Wiedergeburt aller Gläubigen und tauft sie dabei in den Leib Christi (Joh 3,3-8; 1Kor 12,13; Tit 3,5). In Folge davon bewohnt, heiligt, lehrt und bevollmächtigt der Heilige Geist diese zum Dienst und versiegelt sie bis auf den Tag der Erlösung (Röm 8,9; 2Kor 3,6; Eph 1,13). Jeder Gläubige hat die innewohnende Gegenwart des Heiligen Geistes vom Augenblick der Errettung an, und es ist die Verantwortung aller, die aus dem Geist geboren sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt, d.h. von Ihm beherrscht und geleitet, zu sein (Joh 16,13; Röm 8,9.14; Eph 5,18; 1Joh 2,20.27).
Der Heilige Geist begabt und befähigt die Gemeinde mit geistlichen Gnadengaben zum Dienst am Reich Gottes. Dabei teilt Er in Seiner Souveränität jedem Gläubigen die unterschiedlichen Gnadengaben aus, die Er für Ihn vorgesehen hat zur Auferbauung der Gemeinde (Röm 12,3.4; 1Kor 12,11.29.30; Eph 4,12.16). Über diese Gnadengaben kann der Gläubige nicht nach Belieben verfügen, sondern sie nur in der Kraft des Geistes ausüben, da er vollständig von Ihm abhängig ist (Joh 3,8; 2Kor 3,5.6; vgl. Joh 15,5). Durch die Gnadengaben verherrlicht der Heilige Geist weder Sich selbst noch Seine Gaben durch demonstrative Zurschaustellung, sondern Er verherrlicht Christus, indem Er Sein Werk ausführt, die Verlorenen zu erlösen und die Gläubigen im Glauben aufzuerbauen (Joh 16,13.14; Apg 1,8; 2Kor 3,18). Grundsätzliche Kennzeichen eines erfüllten Christseins und der wahren Errettung sind allein der Glaube an das Evangelium und die Leitung durch den Heiligen Geist, nicht der Besitz einer speziellen Gnadengabe (Röm 8,14; Eph 1,13). Der Heilige Geist bestätigte zur Zeit Jesu und Seiner Apostel das Evangelium in konzentrierter Weise mit Zeichen und Wundern (Mk 16,19.20; Röm 15,18.19; Hebr 2,3.4). Vor allem zu diesem missionarischen Zweck können auch heute noch Wunder und zeichenhafte Gnadengaben von Gott gegeben werden. Diese werden jedoch immer allein zur Ehre Jesu sein, und sollten diesbezüglich geprüft werden, auch um betrügerische Zeichen des Feindes zu entlarven (5Mose 13,1-4; 1Kor 14,29; 1Thess 5,21; 2Thess 2,9.10; 1Joh 4,1-3).
3. Der Mensch (Anthropologie)
Die Schrift lehrt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau in Seinem Ebenbild zu Seiner Ehre erschaffen hat, mit gleicher Würde, jedoch unterschiedlichen Rollen. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch absolut verdorben und steht erlösungsbedürftig unter Gottes gerechtem Zorn.
Die Schrift lehrt, dass der Mensch direkt und unmittelbar von Gott nach Seinem Bilde, Ihm ähnlich, als Einheit aus Geist-Seele und Leib (dichotom) geschaffen wurde (1Mose 2,7; Jak 2,26). Er wurde mit dem Auftrag geschaffen über die Schöpfung zu herrschen, in Gemeinschaft mit Gott und seinen Mitmenschen zu leben, frei von Sünde, mit Verstand und Intelligenz, freiem Willen, Selbstbestimmung und moralischer Verantwortung gegenüber Gott (1Mose 1,26.27; 2,15-25; Jak 3,9). Aus dieser Gottesebenbildlichkeit erwächst die Würde des Menschen, die schon mit der Befruchtung beginnt und unveräußerlich ist (2Mose 21,22.23; Ps 139,15.16; Jer 1,5; Lk 1,44).
Gott erschuf den Menschen aus, durch und zu Christus hin mit der Bestimmung, Gott zu verherrlichen (Jes 43,7; Röm 1,21; Kol 1,16). Zu diesem Ziel wird Er mit jedem Menschen durch Gericht oder Gnade kommen (Spr 16,4; Röm 9,22-24; Phil 2,10.11). In den Kindern Gottes kommt diese Bestimmung in besonderer Weise zur Erfüllung, da Gott sie vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, in das Bild Christi verwandelt zu werden (Röm 8,29; Eph 1,4; 1Petr 1,20), indem sie sich an der Gemeinschaft mit Ihm erfreuen und dadurch nach Seinem Willen leben (Röm 11,36; Eph 2,10; Phil 4,4; Offb 4,11).
Der Mensch hat seine Unschuld durch Adams Sünde des Ungehorsams gegenüber dem geoffenbarten Willen und Wort Gottes verloren (1Mose 2,16.17; Röm 3,23; 5,12-19). Da alle Menschen in Adam waren und darum sein verdorbenes Wesen an alle Menschen aller Zeiten weitergegeben wurde, sind alle von Natur aus Sünder vom Mutterleib an (Röm 3,9-18.23; 5,12.19; 1Kor 15,21.22) – sowohl durch eigene Wahl, als auch durch göttliche Bestimmung (Röm 9,17-24; 1Petr 2,8). Damit wurde jeder Mensch von Gott entfremdet, zog sich die Strafe des körperlichen Todes und der ewigen Verdammnis zu, verfiel dem Zorn Gottes und wurde von Natur aus verdorben und aus sich heraus total unfähig, das zu wählen oder zu tun, was Gott gefällt (1Mose 3,16-19.24; Jes 59,2; Joh 3,36; Röm 6,23; 1Kor 2,14; Eph 2,1-3). Die Rettung des Menschen ist darum vollständig von Gottes Gnade in Christus abhängig (Eph 2,4-8).
Zudem lehrt die Schrift, dass Gott den Menschen in Seinem Ebenbild als Mann und Frau schuf (1Mose 1,27; 2,18.21-23; 5,2; Jak 3,9). Somit gibt es nur diese zwei gottgewollten Geschlechter, deren Identität sich unveränderbar aus dem bei der Befruchtung von Gott festgelegten biologischen Geschlecht ergibt. Ihnen gab Gott den Auftrag, sich zu vermehren und auf der ganzen Erde auszubreiten, um über sie verantwortlich zu herrschen (1Mose 1,28). Männer und Frauen sind als gleichwertige Ebenbilder Gottes geschaffen und genießen gleichermaßen Zugang zu Ihm durch den Glauben an Jesus Christus und sind beide berufen, sich in Familie, Gemeinde und Gemeinwesen zu engagieren (1Mose 9,6; Ps 139,13.14; Gal 3,28). In dieser Gleichwertigkeit, hat Gott es so in Seiner Weisheit vorgesehen, dass Mann und Frau nicht austauschbar sind, sondern sich vielmehr auf eine gegenseitig bereichernde Art und Weise ergänzen (1Mose 2,18). Sie sollen unterschiedliche Rollen innehaben, welche die liebende Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegeln: der Ehemann, indem er seine Funktion als Haupt seiner Familie so ausübt, dass er die aufopfernde, reinigende, sorgende und beständige Liebe Christi darstellt; die Ehefrau, indem sie sich ihrem Mann so unterordnet, dass dadurch die Liebe und Ehrfurcht der Gemeinde für ihren Herrn erkennbar wird (1Kor 11,3; Eph 5,21-33; Kol 3,18.19). Darum hat Gott das Ältestenamt innerhalb der Gemeinde nur qualifizierten Männern vorbehalten (1Tim 2,12-14; 3,2-7; Tit 1,6-9). Mann und Frau sollen sich in der ehelichen Vereinigung zu einem Fleisch somit komplementär ergänzen. Die monogame und heterosexuelle Ehegemeinschaft ist damit die einzige von Gott gewollte Form der sexuellen menschlichen Beziehung und der familiäre Rahmen und Schutzraum für Kinder (1Mose 2,24; Röm 1,26.27).
4. Die Erlösung des Menschen (Soteriologie)
Die Schrift lehrt, dass Gott Menschen durch Erwählung, Wiedergeburt und Rechtfertigung allein aus Gnade durch Glauben an Christus rettet und sie durch den Heiligen Geist heiligt, sicher bewahrt und des ewigen Lebens gewiss macht.
Die Schrift lehrt, dass die Errettung allein von Gott und aus Gnade durch Glauben zur Ehre Gottes ist. Diese gründet auf dem Erlösungswerk Jesu Christi, durch den Verdienst Seines vergossenen Blutes, und nicht in menschlichen Verdiensten oder Werken (Joh 1,12; Eph 1,7; 2,8-10; 1Petr 1,18.19). Somit errettet uns Gott von sich (Seinem Zorn), für sich und durch sich selbst.
4.1 Erwählung
Die Schrift lehrt, dass die Erwählung ein Werk Gottes ist, durch das Er vor Grundlegung der Welt in Christus die Seinen erwählt hat, die Er aus Gnade erneuert, errettet, heiligt und verherrlicht (Mt 11,25-27; Joh 17,9; Röm 8,28-30; 9,22.23; Eph 1,4-6.11; 2Thess 2,13; 2Tim 2,10; 1Petr 1,1.2).
Gottes souveräne Erwählung steht weder im Widerspruch zur Verantwortung des Menschen, Buße zu tun und Christus als Herrn und Retter zu vertrauen, noch hebt sie diese Verantwortung auf (Hes 33,11; Joh 3,18.19.36; 5,40; 2Thess 2,10-12; Offb 22,17). Trotzdem wird die souveräne Erwählung immer zu dem von Gott bestimmten Ziel führen, da Seine souveräne Gnade sowohl die Mittel zum Empfangen der Gabe der Errettung, als auch die Errettung selbst beinhaltet. Alle, die der Vater zu Sich ruft, werden im Glauben kommen und alle, die im Glauben kommen, wird der Vater annehmen und am letzten Tag auferwecken (Joh 6,37-40.44; Apg 13,48; 2Tim 1,9).
Die unverdiente Güte, die Gott völlig verdorbenen Sündern in der Erwählung erweist, hat nichts mit einer Initiative ihrerseits zu tun, noch damit, dass Gott lediglich im Voraus weiß, was die Menschen aus ihrem Willen heraus tun werden; es handelt sich allein um Seine souveräne Gnade und Barmherzigkeit (Joh 1,12.13; Röm 3,11; 9,11-18; Eph 1,4-7; 2,8.9; Tit 3,4.5). Diese Erwählung steht im Einklang mit Gottes anderen Wesenseigenschaften und geschah in Liebe (5Mose 7,7.8; Eph 1,4).
4.2. Wiedergeburt
Die Schrift lehrt, dass die Wiedergeburt ein souveränes, übernatürliches Werk des Heiligen Geistes ist, über das der Mensch nicht selbst verfügen kann (5Mose 30,6; Joh 3,8; 6,44.45). Der Mensch wird dabei eine neue Kreatur, indem er ein neues Herz (Gesinnung) erhält, welches von Gott nicht wiederhergestellt, sondern von Grund auf neu geschaffen wird (Hes 36,26.27; 2Kor 5,17.18; Tit 3,5).
Die Wiedergeburt geschieht allein durch den Heiligen Geist mittels des Evangeliums aus dem Wort Gottes (Röm 10,17; 1Petr 1,23.25; Jak 1,18). Ihr werden Buße und Glaube des wiedergeborenen Sünders folgen, der daraufhin gerechtfertigt und als Kind Gottes angenommen wird (Klgl 5,21; Joh 1,12.13; 1Kor 2,12-14; 2Kor 4,4-6). Zu keiner Zeit wurde ein Mensch auf eine andere Weise gerettet (Ps 80,19; Joh 3,5; Hebr 11).
Weitere Auswirkungen der Wiedergeburt sind u.a. die Versetzung eines Menschen aus der Gewalt des Satans in das Reich Gottes (Kol 1,12.13), die Wahrnehmung der Herrlichkeit Gottes und der geistlichen Realitäten (Joh 3,3; 1Kor 2,12-14), den vollständigen Empfang des Heiligen Geist und der Versiegelung mit Ihm (Eph 1,13), und die Befähigung aus Liebe zu Gott nach Seinem Willen zu leben (Röm 5,5; Gal 5,22; Hebr 10,16).
4.3. Rechtfertigung
Die Schrift lehrt, dass die Rechtfertigung eines Menschen vor Gott ein einmaliges Werk Gottes ist (Röm 8,33; 1Kor 6,11; Hebr 10,1.2.14), bei dem Er augenblicklich diejenigen für gerecht erklärt (Lk 18,13.14; 23,42.43; Röm 5,1; Gal 3,24-26), die an das Evangelium von Jesus Christus glauben (Hab 2,4; Gal 2,16) und von ihren Sünden Buße tun (Jes 55,6-7; Apg 2,38; 3,19). Weder die Werke (was er tut), noch das Wesen (was er ist) des Menschen tragen zum Vollzug dieser Rechtfertigung bei (Röm 3,20.28; 4,6; Eph 2,8.9). Durch die Rechtfertigung erlangt der Mensch keine eigene, ihm innewohnende, sondern eine erklärte zugerechnete (forensische) Gerechtigkeit (Röm 4,3-8; 1Tim 1,15). Diese beinhaltet, dass unsere Sünden auf Jesus Christus gelegt werden (Jes 53,5.6; 1Kor 15,3; Kol 2,14; 1Petr 2,24) und uns im Gegenzug Seine Gerechtigkeit zugerechnet wird (Imputation), welche Er durch Sein vollkommenes Leben erwirkte (1Kor 1,30; 2Kor 5,21). Auf diese Weise kann Gott „gerecht sein und den rechtfertigen, der des Glaubens an Jesus ist“ (Röm 3,26)..
4.4. Heiligung
Die Schrift lehrt, dass jeder Gläubige in Christus eine heilige Stellung hat, die unabhängig von seinem gegenwärtigen Wandel ist (Röm 1,7; Hebr 13,12). Weil Gott selbst heilig ist (3Mose 19,2; 1Petr 1,16), beginnt mit der Rechtfertigung zugleich ein Prozess der Heiligung (Röm 6,19.22; 1Thess 4,3), der in der Verherrlichung der Gläubigen seinen Abschluss finden wird (Phil 3,20.21; Kol 3,4; 1Joh 3,2).
Heiligung ist die zunehmende Umgestaltung des Gläubigen in das Bild und Wesen Christi, das Ausleben der neuen Schöpfung in seinem täglichen Wandel, das Ablegen der Sünde und die Absonderung von der gottesfeindlichen Gesinnung und dem bösen Handeln der Welt (2Kor 4,16; 6,14-7,1; Kol 3,10; 1Joh 2,15.16). In diesem Leben ist eine vollständige Ausrottung der Sünde in uns jedoch nicht möglich (1Kön 8,46; Jak 3,2; 1Joh 1,8.10). Erst bei Christus wird der Gläubige völlig von der Gegenwart der Sünde befreit (Röm 8,23; 1Kor 15,49; Offb 21,27).
Die Heiligung ist das Werk des dreieinigen Gottes im Gläubigen, der allein die Macht dazu hat (1Kor 1,30; Phil 2,13; Hebr 2,11; 13,21; 1Petr 1,2). Zugleich schließt dieses Werk Gottes die Verantwortung des Gläubigen ein, mit allem Eifer der Heiligung nachzustreben, um seinen Herrn und Erlöser zu ehren (Joh 8,11; 2Kor 7,1; Hebr 12,14; 2Petr 1,5-7). Die Mittel zu dieser Heiligung sind vor allem Gottes Geist, Sein Wort, die Gemeinschaft der Heiligen sowie das Gebet (Mt 6,13; Joh 17,17; Röm 15,16; Eph 5,26; Hebr 10,24.25), die den Gläubigen auf Christus und Sein Evangelium ausrichten (1Kor 1,30; 2Kor 3,18; Tit 2,11.12). Das mosaische Gesetz des Alten Bundes ist dabei nicht in erster Linie unmittelbarer moralischer Maßstab für das Gott wohlgefällige Leben eines Christen, auch wenn wir es im Lichte des Neuen Bundes durchaus als Spiegel, Riegel und Regel gebrauchen sollen (Röm 7,1-6; 1Kor 10,11; Kol 2,16.17; 1Tim 1,8.9; Hebr 7,12).
4.5. Heilssicherheit
Die Schrift lehrt, dass alle Erlösten, die einmal errettet wurden, in Christus für immer sicher sind (Ps 37,28; Joh 6,39; Röm 8,1; 1Kor 1,8). Gottes Kraft und Seine Mittel (wie z.B. Warnungen zur Buße) bewahren den Gläubigen durch alle Anfechtungen und Schwachheiten hindurch, sodass dieser niemals endgültig abfallen oder sich selbst absolut von Christus lossagen kann, und deswegen bis ans Ende ausharren wird (Joh 10,27-30; Röm 8,31-39; Phil 2,12.13; 1Petr 1,4.5). Dieses Ausharren des Gläubigen ist ein Zeichen wahren Glaubens (Mt 10,22; 1Kor 15,2; Hebr 3,14; 1Joh 2,19).
Es ist das Privileg der Gläubigen sich der Gewissheit ihrer Errettung, durch das Zeugnis der Schrift und die inwendige Bestätigung des Heiligen Geistes, zu erfreuen (Jes 49,13-16; Röm 8,16; 1Joh 3,24). Die daraus resultierende christliche Freiheit darf dabei niemals als Entschuldigung für ein sündiges Leben missbraucht werden (Röm 6,15; Gal 5,13; Tit 2,11-14).
5. Die Gemeinde (Ekklesiologie)
Die Schrift lehrt, dass die wahren Gläubigen aller Zeiten aus Juden und Heiden gemeinsam das Volk Gottes bilden, welches so dem Herrn in der Kraft Seines Geistes dient und sich an Ihm erfreut. In eigenständigen Ortsgemeinden verkündigen sie das Evangelium, taufen Gläubige und erinnern sich regelmäßig im Abendmahl an den Neuen Bund.
Die Schrift lehrt, dass die durch Glauben Gerechtfertigten aufgrund ihrer Gottesbeziehung Seine Kinder sind (Familie Gottes) und somit zu Seiner Gemeinde bzw. Seinem Volk gehören. Um diese Gottesbeziehung zu beschreiben, verwendet die Bibel verschiedene Bilder wie Tempel Gottes (1Kor 3,16), Braut Christi (Eph 5,31.32), Leib Christi (1Kor 12,12.13), Israel Gottes (Gal 6,16), Zion und himmlisches Jerusalem (Hebr 12,22), usw. Die Gemeinde wurde von Gott erwählt, wiedergeboren, gerechtfertigt und geheiligt, um Ihn zu verherrlichen (s. Kapitel 4).
5.1. Die universale Gemeinde
Die Schrift lehrt, dass die Gläubigen aus allen Zeiten aus Juden und Heiden die weltweite universale Gemeinde Gottes bilden, deren Haupt Jesus Christus ist (1Mose 12,3; Röm 1,16.17; Eph 1,22; 3,6; Hebr 8,8-13). Die Bildung der Gemeinde fing zu alttestamentlichen Zeiten mit dem ersten Gläubigen an (Röm 9,8; Hebr 11,4) und war danach mehrheitlich auf Israel fokussiert (5Mose 7,6; Mt 10,5.6; Apg 13,46; Röm 1,16), weitete sich ab Pfingsten aber in besonderer Weise und in größerem Maß weltweit auf alle Völker aus (Hos 2,1.25; Mt 28,18-20; Apg 15,16.17). Alle Wiedergeborenen werden durch den Glauben an Christus Teil dieser universalen Gemeinde (1Kor 12,13; Gal 3,7.26-28).
Diese Gemeinde hat kein irdisches Reich (Joh 18,36). Sie ist weltweit verstreut und repräsentiert als Leib Christi ihren Herrn sichtbar auf der ganzen Welt (Eph 3,10; 1Petr 1,1). Sie hat als Volk Gottes schon jetzt eine himmlische Stellung, obwohl sie noch auf der Erde ist (Kol 1,13). Wer in Christus entschlafen ist, ruht bis zur Wiederkunft Jesu in der himmlischen Gemeinde der vollendeten Gerechten (Hebr 12,22-24; Offb 6,9-11; 14,13).
5.2. Die Ortsgemeinde
Die Schrift lehrt, dass die eine, universale Gemeinde sich in vielen einzelnen Ortsgemeinden darstellt (1Kor 1,2; Offb 1,4.11). Die Glieder des einen geistlichen Leibes sind aufgefordert sich in örtlichen Gemeinschaften verbindlich und regelmäßig zu versammeln, weil sie aufeinander angewiesen sind (Apg 2,46; 1Thes 5,11.14; Hebr 10,19-25). In all diesen Versammlungen ist Jesus Christus und sein Evangelium der Mittelpunkt, weil Er das Haupt der Gemeinde ist (Eph 1,22.23; 3,21; 4,15; 5,23). Darüber hinaus ist die Ortsgemeinde aufgefordert, dieselbe Gesinnung über die Person und das Werk Jesu Christi zu haben (Röm 15,5-7; 1 Kor 1,10; Eph 4,3.13).
Der Zweck der Ortsgemeinde ist die Verherrlichung Gottes, indem sie vor allem Sein Wort verkündigt und befolgt, geistliche Gemeinschaft pflegt, Ihn durch Gebet und Lieder lobt, durch Gnadengaben dient, sich im Abendmahl an den Bund erinnert und ihn in der Taufe bezeugt (Mt 28,19.20; Apg 2,38-42; Eph 3,21; Kol 3,16; 1Kor 11,25.26; 1Petr 4,10.11).
Obwohl jede Ortsgemeinde in ihrer Leitung eigenständig ist (Apg 20,28; Hebr 13,17; 1Petr 5,2), lehrt die Schrift eine gegenseitige Verantwortung in der geistlichen sowie materiellen Unterstützung anderer bibeltreuer Ortsgemeinden (Apg 14,24-28; Röm 15,26-27; 2Kor 8,1-5; Kol 4,16). Sollte aus lehrmäßigen Gründen eine Zusammenarbeit nicht möglich sein, erachten wir diese Christen weiterhin als Geschwister (Apg 15,39.40; Röm 14,1-5). Wir distanzieren uns jedoch von jeder Gemeinschaft, die nicht in der Lehre des Christus bleibt oder darüber hinaus geht (Gal 1,8; Tit 3,9-11; 2Joh 8.9).
5.3. Die Leitung der Ortsgemeinde
Die Schrift lehrt, dass der Herr Jesus Christus eine solche örtliche Zusammenkunft von Christen durch Seinen Heiligen Geist, insbesondere mittels des Wortes, leitet. Diese Leitung wird durch mehrere von Gott begabte, und berufene männliche Älteste ausgeübt (Apg 20,28; Eph 4,11.12), welche dafür allein die in der Schrift aufgelisteten Voraussetzungen erfüllen müssen (1Tim 3,1-7; Tit 1,5-9; 1Petr 5,1-4). Eine theologische Ausbildung kann hilfreich sein, ist jedoch nicht zwingend zu diesem Pastorendienst notwendig. Die Schrift bezeichnet dieses Amt eines Gemeindeleiters auch als Aufseher/Bischof, Hirte/Pastor oder Verwalter (s.o.; Hebr 13,17).
Die Ältesten leiten als Christi Diener und haben Christi Autorität für die Führung der Gemeinde, der sich die Versammlung in geistlichen Fragen unterzuordnen hat (1Thess 5,12.13; 1Tim 5,17-22; Hebr 13,7.17). Dabei sollte die Leiterschaft nicht herrschend geschehen, sondern von Liebe, Dienstbereitschaft und Demut nach dem Vorbild Christi geprägt sein (Mt 20,26-28; 1Petr 5,3). Daher kann die Gemeinde in bestimmte Entscheidungsprozesse mit hineingenommen werden, wobei sie die Entscheidungen der Ältesten mitträgt (Apg 6,3; 15.22.25).
Neben den Ältesten hat Gott der Gemeinde vom Geist erfüllte Diakone zur Verfügung gestellt, die der Gemeinde in praktischen und geistlichen Bereichen dienen und in diesen Verantwortung übernehmen (Apg 6,2-4; 1Tim 3,8-13). Für sie gelten ähnliche Kriterien wie für Älteste (1Tim 3,8-13).
5.4. Die Gaben des Geistes zum Dienst in der Gemeinde
Die Schrift lehrt, dass alle Glieder des Leibes Christi zum Werk des Dienstes berufen sind, um den Leib zu erbauen und dadurch Gott zu verherrlichen (1Petr 4,10.11). Um diese Berufung auszuleben, teilt Gott jedem einzelnen Gläubigen nach seinem Willen verschiedene geistliche Gaben aus (Eph 4,7-13). Alle Gaben werden durch ein und denselben Heiligen Geist gewirkt und ausgeteilt, und sind allesamt gleich notwendig (Röm 12,4-8; 1Kor 12,4-31). Auch wenn die Gnadengaben keine natürlichen Begabungen sind, sind die Gläubigen dazu aufgefordert sie zu gebrauchen, und in ihnen zu wachsen (1Tim 4,14.15; 2Tim 1,6).
Während der apostolischen Zeit bestätigten die Wunder- und Offenbarungsgaben die Glaubwürdigkeit der Botschaft der Apostel von Jesus Christus (Apg 5,12; 2Kor 12,12; Hebr 2,3.4). In Situationen, in denen Gott heute die Notwendigkeit sieht, können solche Gaben immer noch vom Geist gewirkt werden (Mk 16,17-20; Apg 11,27.28), allerdings in einer abklingenden Fülle (1Kor 13,8; 2Tim 4,20), und ohne Ergänzung zum inspirierten Kanon (Jud 3; Offb 22,18.19). Diese Gaben sollten stets anhand der Schrift geprüft werden, da Zeichen und Wunder auch auf das verführerische Wirken Satans zurückzuführen sein können (5Mose 13,1-4; Mt 24,24; 1Kor 14,29; 1Thess 5,20.21).
5.5. Die Zeichenhandlungen der Gemeinde: Taufe und Abendmahl
Die Schrift lehrt, dass der Herr Jesus Seiner Gemeinde zweiVerordnungen anvertraut hat: die Taufe und das Mahl des Herrn (Mt 28,19; 1Kor 11,24.25). Diese Verordnungen vermitteln in sich selbst keine Rettung, sondern sind symbolische Handlungen, die Gott eingesetzt hat, um uns im Glauben an die bereits vollständig erhaltene Gnade zu stärken (1Petr 3,21; 1Kor 11,24-27).
Mit der christlichen Taufe durch Untertauchen (Joh 3,23; Apg 8,38.39) bezeugt ein i.d.R. Neubekehrter einmalig, dass er an den gestorbenen, begrabenen und auferstandenen Retter glaubt, mit ihm vereint ist im Kreuzestod und in der Auferstehung, und er dadurch ewiges Leben empfangen hat (Mt 28,19.20; Apg 2,38; Röm 6,3-6). Diese Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes drückt die Übereignung und Zugehörigkeit zu Gott, sowie die Gemeinschaft und Identifizierung mit dem sichtbaren Leib Christi aus (Apg 2,41.42; 1Kor 12,13; Gal 3,27). Die Säuglingstaufe, wie sie manche Geschwister praktizieren, wird nicht als biblische Taufe angesehen, da Jesus Christus die Taufe nur für Jünger verordnete, bei denen Buße und Glaube vorhanden sind (Mt 28,19; Apg 8,37). Nur Gläubige können die geistliche Wahrheit der Vereinigung mit Christus in seinem Tod und Auferstehen bezeugen (Röm 6,3-6). Die Apostelgeschichte berichtet daher ausschließlich, dass die Taufe in der Urgemeinde nur an denen durchgeführt wurde, die dem Wort glaubten (Apg 2,41; 16,31-34; 18,8; 19,3-5).
Während die Taufe einmalig im Leben eines Christen erfolgt, soll das Mahl des Herrn einen Christen regelmäßig an das Leben und Sterben Jesu und somit unsere Rechtfertigung im neuen Gnadenbund als Gedächtnismahl erinnern (Lk 22,19; Apg 20,7; 1Kor 11,24.25). Des Weiteren ist das Abendmahl ein Verkündigungsmahl, womit die Gemeinde sich gegenseitig, aber auch ungläubigen Gästen, dieses Werk des Herrn verkündigt (1Kor 11,26). Durch diese Verkündigung wird es gleichzeitig auch ein Erwartungsmahl der Wiederkunft Jesu (1Kor 11,26). Durch das gemeinsame Brot und den gemeinsamen Kelch drücken die Gläubigen ihre Gemeinschaft untereinander und mit dem Erlösungswerk Jesu aus, der im Abendmahl in besonderer Weise gegenwärtig ist (keine Trans- und Konsubstantiation) und mit den Seinen Gemeinschaft hat (Gemeinschaftsmahl: 1Kor 10,16.17). Ziel dieser Verordnung ist die regelmäßige Stärkung der Gemeinde bis zur Ankunft Ihres Herrn. Dafür soll der Teilnahme am Mahl eine ernsthafte Selbstprüfung vor dem Herrn vorausgehen und die örtliche Gemeinde muss prüfen, wen sie zum Mahl empfangen kann und wen nicht (1Kor 5,6-11; 11,27-32; 2Kor 6,14.15).
5.6. Die Zucht der Gemeinde
Die Schrift lehrt, dass die Gemeinde aufgefordert ist, heilig zu wandeln (2Tim 2,20.21). Jeder Gläubige hat hierbei den Auftrag, dass die gesamte Gemeinde christusgemäß lebt (Mt 18,15–17; Gal 6,1). Wenn ein Glied der Gemeinde anhaltend in Sünde verharrt, ist die Gemeinde aufgefordert, Gemeindezucht zu üben (1Kor 5,1-13; 2Thess 3,6-15). Ziel dieser Erziehungsmaßnahme ist die Umkehr von der Sünde und, im Falle eines notwendig gewordenen Ausschlusses, die Wiederaufnahme in die Gemeinde als dem Schutzraum Gottes (Mt 18,18-20; 1Kor 5,5; 2Kor 2,5-11).
5.7. Der Staat und die Gemeinde
Die Schrift lehrt, dass die Jünger Jesu schon jetzt Bürger des himmlischen Reiches sind, und dennoch in irdischen Reichen leben (Phil 3,20). Über diese gefallenen Reiche setzt Gott in Seiner Gnade menschliche Obrigkeiten als Diener ein (Röm 13,1.2; 1Petr 2,13.14). Dabei sind alle, ob gute oder böse, von Gott verordnet (Dan 2,21; Hab 1,12). Jesus Christus gebraucht sie souverän zur Umsetzung Seines Ratschlusses (Spr 21,1; Jes 45,1-5; Hab 1,12). Die Obrigkeiten haben von Ihm die Vollmacht als Verwalter und die Befugnis Gerechtigkeit zu üben, um das irdische Zusammenleben in einer gefallenen Welt zu ermöglichen (1Mose 9,5.6; Röm 13,4). Die Gemeinde hat den Auftrag für die Obrigkeiten das Beste zu suchen (Jer 27,17; 29,7; 1Tim 2,1.2) und sich ihnen in allem unterzuordnen (2Mose 22,27; Röm 13,1.3-7), außer bei Anordnungen, die sich klar dem Wort Gottes widersetzen (Dan 3,18; Apg 4,19; 5,29).
6. Die Engel (Angelologie)
Die Schrift lehrt, dass Gott Engel zum Dienst an Seinem Ratschluss geschaffen hat, wobei die bewahrten Engel willig Seinem Volk dienen und Er diejenigen richten wird, die sich gegen Ihn gestellt haben.
Die Schrift lehrt, dass Engel erschaffene Geistwesen sind und deshalb nicht angebetet werden dürfen (Kol 2,18; Offb 19,10; 22,8.9).
Die Schrift lehrt, dass Gott die Engel schuf, um Ihn ewig zu verherrlichen (Hebr 1,6.7; Offb 5,11.12). Diejenigen Engel, die Gott erwählte, bewahrt Er vor Sünde, sodass sie Ihm ewig dienen (1Tim 5,21). In diesem Dienst nutzt Gott sie u.a. als Boten (Sach 1,9; Lk 1,30.34), Diener an den Heiligen (1Mose 19,1-22; Dan 12,1; Mt 18,10; Apg 5,19; Hebr 1,14), zur Ausübung von Gericht (Offb 8,5; 16,1) und als Kämpfer in der geistlichen Welt (2Kön 6,17; Offb 12,7; 20,1-3). Die Schrift lehrt, dass Satan ein geschaffener Engel und der Urheber der Sünde ist. Er zog das Gericht Gottes auf sich, indem er gegen seinen Schöpfer rebellierte (Jes 14,12-17; Hes 28,11-19), zahlreiche Engel in seinem Fall mit sich zog (Offb 12,3.4) und die Sünde in die Welt hineinbrachte (1Mose 3,1-15). Dadurch ist er der erklärte Feind Gottes und der Menschen (Mt 4,1-11; Joh 8,44; Offb 12,9.10), dem Gott in Seiner Souveränität eine festgesetzte Herrschaft über die gefallene Welt gewährt (Eph 2,2; Offb 12,12). Dabei versucht er, gemeinsam mit seinen Handlangern, den Dämonen (Dan 10,13; Mk 3,22), die Menschheit von ihrer Bestimmung, Gott anzubeten, abzubringen (2Kor 4,4; 1Petr 5,8; Offb 12,13). Jesus Christus hat ihn und seine Dämonen durch Sein Leben, Seinen Tod und die Auferstehung überwunden und wird sie für ewig im Feuersee bestrafen (Mt 25,41; Offb 20,10).
7. Die letzten Dinge (Eschatologie)
Die Schrift lehrt, dass Gottes Volk in der seit Jesu erstem Kommen begonnenen Endzeit bedrängt wird und dennoch weltweit wächst. Doch Christus kommt wieder und wird die Gottlosen auf ewig in der Hölle bestrafen. Sein Volk darf sich jedoch ewiger Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott erfreuen, zur Ehre Gottes.
Die Schrift lehrt, dass die Endzeit mit dem ersten Kommen Jesu begann (Apg 2,17; Hebr 1,2), bis zu Seiner Wiederkunft voranschreitet (Mt 13,39.40; 1Kor 15,23.24), und in der Ewigkeit vollendet wird (2Petr 3,9-13). In dieser Spannung und Erwartung lebt der Gläubige (Lk 21,27.28; 1Kor 16,22), da er in diesem „Schon-Jetzt und Noch-Nicht“ bereits die Auswirkungen seiner Erlösung als neue Schöpfung erlebt, aber noch auf die Vollendung dieser wartet (Röm 8,23.24; 2Kor 5,17; Hebr 6,4.5).
7.1 Kennzeichen der Endzeit
Die Schrift lehrt, dass die Endzeit einerseits durch die Ausbreitung des Reiches Gottes, sowie durch zunehmenden Abfall und Bedrängnis geprägt ist. Nach Jesu Verheißung wird das Evangelium vor Seiner Wiederkunft auf der ganzen Erde gepredigt werden, sodass Menschen aus allen Nationen in Sein Reich versetzt werden (Mt 13,31-33; 24,14; Apg 1,6-8). Zugleich ist diese Zeit geprägt von Verführung und Abfall der Nicht- und Namenschristen, der sich in Unglauben und gottlosem Leben äußert (Mt 24,12; 2Thess 2,3; 2Tim 3,1-7). Für Kinder Gottes ist diese Drangsalszeit von Verfolgung und Verführung gekennzeichnet, aus denen die Gläubigen durch Gottes Bewahrung als Überwinder hervorgehen (Mk 13,6-9; Offb 13).
In all diesem übt Jesus Christus sein Gericht über diese gottlose Welt aus und läutert damit zugleich Seine Gemeinde (Röm 1,18; 2Thess 2,11.12; 1Petr 4,17; Offb 6-20).
7.2. Wiederkunft und Entrückung
Die Schrift lehrt, dass Christus zur Vollendung der Endzeit bald ein einziges Mal plötzlich, persönlich, leiblich und sichtbar wiederkommen wird, um Gottes Ratschluss zu vollenden und Lebende und Tote zu richten (Sach 14,4.5; Mt 24,26-44; 2Thess 1,7-10; Offb 1,7; 22,12).
Bis dahin befinden sich die Verstorbenen in einem Zwischenzustand: Die Seelen/Geister der Gläubigen befinden sich schon jetzt in der glückseligen Gegenwart Gottes (Lk 23,43; Phil 1,23.24; 1Thess 4,14-17; Offb 6,9-11; 20,4), wohingegen die verstorbenen Ungläubigen schon jetzt im Totenreich (noch nicht der Feuersee) gepeinigt werden (Lk 16,22-26).
Bei der Wiederkunft am Tag des Herrn werden alle Toten wieder auferstehen und ihren neuen Leib erhalten, der mit ihrer Seele vereinigt wird (Dan 12,2; Joh 5,28.29; 1Kor 15,52). Christus wird mit den in Ihm Entschlafenen auf den Wolken des Himmels kommen und Seine auf Erden lebende Gemeinde zu sich entrücken, um für immer mit ihr als Seiner Braut vereint zu sein (Joh 14,3; 1Thess 4,15-17; Offb 14,14-16; 19,7-9). Er wird die alte Schöpfung vernichten, Gericht üben und die Ungläubigen zusammen mit dem Teufel und seinen Engeln auf ewig im Feuersee (Hölle) verdammen (Jes 34,4; Mt 10,28; 2Kor 5,10; 1Thess 1,7-10; 2Petr 3,7.10-13; Offb 20,10-15). Damit wird dieses Zeitalter für immer von der Ewigkeit überwunden sein (Mt 13,39-43; 28,20; 1Kor 15,25.26; 2Petr 3,18).
7.3. Der ewige Zustand
Die Schrift lehrt, dass nach der Wiederkunft Christi die nun endgültig Geretteten in den ewigen Zustand der Herrlichkeit eintreten werden, um die vollkommene Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu genießen (Jes 65,17-19; Joh 17,3; 1Joh 3,2). In dieser neuen Schöpfung wird es keinen Fluch und keinen Tod mehr geben, sondern vollkommene Gerechtigkeit herrschen (Sach 14,11; Offb 21,4.5). Gottes Kinder werden Miterben des verherrlichten Christus sein und so für ewig an Seiner Herrlichkeit Anteil haben (Röm 8,17.18; 2Thess 2,14; Offb 21,11). Damit wird in Christus der ganze Ratschluss Gottes erfüllt sein, und Christus wird das Reich Gott, dem Vater, übergeben, damit in allem und für alle Ewigkeit der dreieinige Gott regiere und darin durch alles verherrlicht werde (Röm 11,36; 1Kor 15,24-28; Offb 10,7). Amen!
8. Weitere Bekenntnisse
Neben diesem Glaubensbekenntnis bekennen wir uns noch zu weiteren Bekenntnissen aus der ganzen Kirchengeschichte. Unterschiede in der theologischen Sichtweise sind kurz benannt und gelten auch für die nachfolgenden Bekenntnisse ohne extra aufgeführt zu werden. Die Kapitelangaben sind Referenzen zum obigen Bekenntnis.
8.1. Altkirchliche Bekenntnisse
- Apostolisches Glaubensbekenntnis (Apostolikum 2.-5. Jhd. n.Chr., das als erstes Bekenntnis den Glauben der frühen Gemeinde zusammenfasst): Die Formulierung „hinabgefahren in das Reich des Todes“ (die in den frühesten Fassungen nicht enthalten ist) verstehen wir nicht im Sinne der Höllenfahrt Christi, sondern wie die Reformatoren als Formulierung für sein leibliches Sterben (so auch in den folgenden Bekenntnissen).
- Nicaeisches Glaubensbekenntnis (Nicaeno-Constantinopolitanum: Erstfassung 325 n.Chr. in Nicäa; überarbeitet 381 n.Chr. in Konstantinopel, das besonders die Person und das Werk des Sohnes und des Heiligen Geistes beschreibt): Die Formulierung „aus dem Vater geboren (gr. monogenes) vor aller Zeit“ verstehen wir als Ausdruck der Einzigartigkeit Jesu als Sohn Gottes, die nicht im Widerspruch zu Seiner Präexistenz steht (so auch in den folgenden Bekenntnissen). Zu folgenden Formulierungen bekennen wir uns nicht:
- Das Reden des Heiligen Geistes durch „die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“, die im Bekenntnis parallel zu Gottes Reden durch die Propheten steht. Das inspirierte Reden Gottes endete mit der Vollendung des Kanons (s. Kap. 1);
- „Die eine Taufe zur Vergebung der Sünden“ darf nicht heilsbringend verstanden werden, sondern wie wir sie in Kap. 4.3. und 5.5 bekennen.
- Chalcedonensisches Glaubensbekenntnis (451 n.Chr. aus Chalcedon, in dem es besonders um die Zwei-Naturen-Lehre Jesu geht).
- Athanasianisches Glaubensbekenntnis (4. bis 5. Jhd., das besonders die Dreieinigkeit, die Person und das Werk Jesu beschreibt).
8.2 Reformatorische- und nachreformatorische Bekenntnisse
- Augsburger Bekenntnis (Confessio Augustana von 1530, einem sehr umfassenden Bekenntnis in Abgrenzung zur römisch-katholischen Lehre): Lediglich das Tauf- und Abendmahlsverständnis aus Art. V, IX und X lehnen wir ab (s. Kap. 5.5), sowie teilweise das Ordinationsverständnis aus Art. XIV (s. Kap. 5.3. und 5.4).
- Heidelberger Katechismus (von 1563, der in Fragen und Antworten die Grundlagen des christlichen Glaubens aus reformierter Sicht lehrt): Lediglich das Taufverständnis in Frage 74 lehnen wir ab (s. Kap. 5.5) sowie das Verhältnis zum Gesetz in Frage 91-115 (s. Kap. 4.4).
- Dordrechter Lehrregeln (von 1619, die besonders die totale Verdorbenheit des Menschen, Gottes Erwählung und die Unverlierbarkeit des Heils beschreiben): Lediglich Art. 17 des 1. Lehrstücks, dass „Kinder der Gläubigen […] kraft des Gnadenbundes“ gerettet werden, halten wir für zu Kurz.
- Erstes Londoner Glaubensbekenntnis (von 1644 als einer der ersten umfassenden Baptistenbekenntnisse).
- Westminster Bekenntnis (von 1646, das sehr umfangreich biblische Lehren aus presbyterianischer Sicht darlegt): Den meisten Artikel stimmen wir voll zu, ausgenommen:
- Bezüglich des Verhältnisses von Gnadenbund und dem mosaischen Gesetz sind wir zurückhaltender wie es Art. 7.5 ist. Die Bedeutung des Gesetzes verstehen wir teilweise anders als Art. 19. So sehen wir im Neuen Bund z.B. kein Gebot für das Einhalten des Sabbats (s. Kap. 4.4; Röm 14,5.6; entgegen Art. 21.7);
- Anders als Art. 23.3, glauben wir nicht, dass die weltliche Obrigkeit Autorität hat gegen Irrlehrer und für einen sittlichen Gottesdienst innerhalb der Gemeinde vor zu gehen (s. Kap. 5.7.);
- Ebenso glauben wir nicht, dass die Kinder der Glaubenden zur weltweiten Kirche gehören (gegen Art. 25.2);
- Das Taufverständnis in Art. 28.2-4 lehnen wir ab (s. Kap. 5.5). Auch glauben wir nicht, dass nur ein „ordinierten Diener“ taufen und das Abendmahl austeilen darf (entgegen Art. 27.4);
- Wir glauben, dass es Aufgabe der ganzen Gemeinde ist, nicht nur deren „Amtsträger“, Gemeindezucht zu üben (Kap. 5.6.; entgegen Art. 30.2). Hinter Art. 31 mit der synodalen Gemeindeform stehen wir nicht (s. Kap. 5.2).
- Baptistisches Glaubensbekenntnis (bzw. Zweites Londoner Bekenntnis von 1689, das sehr umfangreich biblische Lehren aus baptistischer Sicht darlegt): Da es auf dem Westminster Bekenntnis aufbaut, stimmen wir den meisten Artikeln voll zu, lehnen neben den dort genannten auch folgende Artikel ab:
- Es erscheint uns besser vom Papst als einem Antichristen zu sprechen, satt „der Antichrist“ wie in Art. 26.4 gesagt;
- Wie in Kap. 7.2 bekannt, ist der aktuelle Aufenthaltsort der gestorbenen Gottlosen nicht die „Hölle“, sondern das Totenreich (entgegen Art. 31.1).
8.3 Aktuelle Bekenntnisse
- Glaubensbasis der Evangelischen Allianz (von 1846, überarbeitet 1972 und 2018, und deren allgemeinen Aussagen über die Lehren der Bibel). Aufgrund der theologisch unpräziseren aktuellen Version ziehen wir die Version von 1972 vor.
- Barmer Theologische Erklärung (von 1934 zum Umgang mit weltanschaulichen und politischen Überzeugungen sowie Machtdemonstrationen des Staates).
- Frankfurter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission (von 1970, die ausführliche Aussagen über die Missionstheologie und deren Verirrungen darlegt). Zur Taufe im 4. Punkt s. Kap 5.5.
- Chicagoer-Erklärungen zur Heiligen Schrift (von 1978, 1982 und 1986, die ausführlich zur Irrtumslosigkeit, Auslegung und Anwendung der Schrift Stellung nehmen).
- Danvers-Erklärung (von 1988 als Erklärung zu biblischer Männlichkeit und Weiblichkeit)
- Schweizer Leitlinien (oder „Leitlinien für den Umgang mit den neuen Fragen nach dem Heiligen Geist“ von 1994, die zur charismatischen Bewegung Stellung nehmen).
- Theologische Grundlage von Evangelium21 (von 2011, die umfangreich biblische Lehren darlegt).
- Nashville Erklärung (von 2017, und deren Aussagen zum Verständnis der biblischen Sexualität).
- Gemeinsam für das Evangelium (von 2022, und deren Aussagen zur Wichtigkeit des wahren Evangeliums in Lehre und Leben).
Da Erkenntnis Stückwerk ist, wollen wir uns auch weiterhin im Licht der Heiligen Schrift prüfen und gegebenenfalls dieses Bekenntnis korrigieren oder erweitern.
„Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist Er, der die Verheißung gegeben hat“ (Hebr 10,23)
soli deo gloria
©: der Text ist Eigentum der Autoren, darf aber für eigene Bekenntnisse genutzt werden – über eine Information darüber würden wir uns freuen